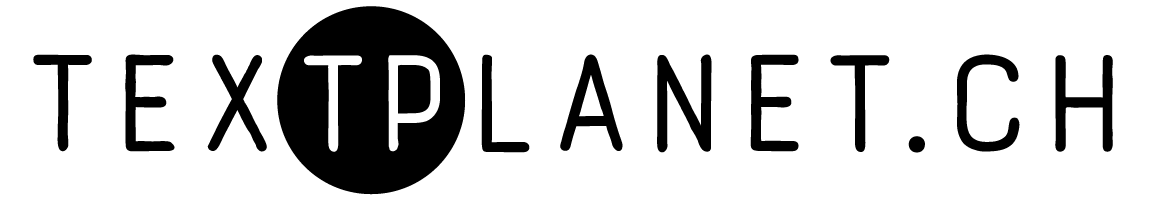Dieser Beitrag ist am 21.12.2018 im Mamablog des Tages-Anzeigers erschienen.
Diesen Text wollen Sie nicht lesen. Und es ist vielleicht ein Fehler, ihn überhaupt zu schreiben. Aber er ist meine letzte Chance, und er ist auch ein Ventil: Dafür, meine Wut loszuwerden, und meine Ohnmacht.

Beginnen wir von vorne. Im August 2016 habe ich an der philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern mein Masterstudium abgeschlossen. Masterarbeit mit Bestnote, sehr guter Notenschnitt insgesamt. Nach acht Jahren Studium – wegen der Kinder, die während dem Studium gekommen waren, hat sich dieses etwas in die Länge gezogen – und acht Jahren träumen, kämpfen, hoffen, mit wenig und nichts auskommen.
Natürlich habe ich ca. mit Beginn des Masterstudiums einen ersten qualifizierten, niedrigprozentigen Teilzeitjob angenommen, mit der Idee, dadurch meine Berufschancen zur verbessern.
Ich habe auch sonst viel unternommen, um mein Profil im Bereich Umweltkommunikation zu stärken: Gezielte Auswahl des Kursangebotes etwa.
Und zuerst scheint es auch zu funktionieren. Ich erhalte bald einen ersten Praktikumsplatz beim Bundesamt für Umwelt BAFU. Die Welt gehört dir, dachte ich mir. Im Anschluss daran: Erst mal nichts. Ich melde mich auf der zuständigen RAV-Stelle. Nach ein paar Monaten mache ich ein zweites Praktikum, diesmal finanziert über die Arbeitslosenkasse.
Das ist wohl der Punkt, an dem unsere familiäre Abwärtsspirale beginnt. Wenige Wochen nach Start dieses Praktikums tritt mein Partner eine neue Stelle an. Und verliert sie wieder zum Ende des ersten Probemonats.
Ich schliesse mein Praktikum ab und mein Partner findet eine neue Stelle. Ich beginne derweil, mich mit dem Thema «Selbständigkeit» zu befassen. Nun habe ich Zeit, in Ruhe meine Selbständigkeit aufzubauen, denke ich mir, denn vom Gehalt meines Partners kann die Familie erst mal leben.
Dann der Schock: Zum Ende der dreimonatigen Probezeit verliert mein Partner auch diese Stelle wieder. Es ist wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Wir sehen vorgängig Null Anzeichen dafür, dass mein Partner auch diese Stelle verlieren würde. Es ist jetzt Ende Juli 2018.
Wir wissen, es bleibt uns ungefähr ein Jahr, um unser Leben auf die Reihe zu kriegen.
Lassen Sie uns über meine Bewerbungen reden. Ich habe in den vergangenen drei Jahren ca. 300 Dossier verschickt und rund 20 Vorstellungsgespräche geführt. Hier eine kurze Zusammenfassung: 2 mal Greenpeace, 2 mal Stadt Bern. Dann: WWF, Solar Agentur Schweiz, Critical Scientist Switzerland, Offcut Basel, Ökozentrum Langenbruck, Raiffeisenbank Winterthur, Filme für die Erde Festival, Kanton Bern, der Bund (Tamedia), Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Gemeinde Steffisburg, Verkehrs-Club der Schweiz VCS, insieme, Kanal K, Berner Fachhochschule, Grüne Kanton Bern.
20 Vorstellungsgespräche – 20 Absagen.
Jedes einzelne Bewerbungsgespräch ist mit hoffen, bangen und schliesslich einem Loch verbunden. Zwar werde ich besser mit der Zeit – die Menschen, welche die Absagen erteilen, kommen zunehmend ins Stocken, erklären und entschuldigen sich, machen klar, dass die Konkurrenz einfach sehr gross war. Dass es nur an wenig gefehlt hat.
Die Absagegründe variieren stark, mal ist es die fehlende Anwendungspraxis in einem Tool, mal wirke ich zu akademisch, mal befürchtet man, ich sei überqualifiziert.
Was ist das Problem? Das Studium? Ja, auf jeden Fall. Aber ich kenne einige (vor allem männliche) Mitstudierende, die unterdessen gut untergekommen sind. Vielleicht, dass ich eine Frau bin und Kinder habe? Möglich. Auf jeden Fall werde ich immer wieder 10 oder 15 Minuten lang nur dazu interviewt, wie die Kinderbetreuung geregelt sei. Selbst bei 50-Prozent-Stellen. (Meinem Partner werden dazu keine Fragen gestellt, auch nicht bei Vollzeitstellen.)
Das Schlimme an den Misserfolgen und Verlusten ist ja, was das sozial mit einem macht. Wir beginnen, Menschen aus dem Weg zu gehen, sorgen bewusst und unbewusst dafür, dass die Kinder nicht mit ihren Freund*innen abmachen. Und wir fühlen uns schlecht, am Rande der Gesellschaft, gereizt, unfähig, wenigstens die Elternrolle gut zu meistern. Und: Wir schämen uns.
(Mühe geben wir uns schon: Wir reden in Anwesenheit der Kinder strikt nicht über unsere Sorgen, weil wir wissen, dass gerade unser älteres Kind schon viel mitkriegen würde. Das hatten wir nicht immer so gut im Griff wie heute, es ist dann schon mal ein «das können wir uns nicht leisten» rausgerutscht – worauf uns besagtes Kind aus dem Wochenende bei den Grosseltern zwei Fünfliber mitgebracht hat, unter der anfänglichen Behauptung, das Geld am Bahnhof gefunden zu haben.)
In wenigen Monaten werde ich ausgesteuert sein, kurz darauf auch mein Partner. Dann droht das Sozialamt, Finanzreserven haben wir keine.
Die Wochentage überstehe ich meist ganz gut. Die Kinder sind in der Schule, ich verschanze mich hinter meinem Projekt Selbständigkeit. Produziere Content, arbeite an meiner Website, bin auf Social Media aktiv. Die Arbeit lenkt mich wenigstens teilweise davon ab, mich in Grübeleien zu verlieren und depressiv zu werden.
Schlimmer sind die Wochenenden. Wir ziehen uns zurück, Ausflüge (von Waldspaziergängen mal abgesehen) können wir uns ohnehin nicht leisten. Die Familienzeiten sind für mich unerträglich, meine Gedanken sind anderswo. Manchmal weine ich. Dann entscheide ich mich, in die Bibliothek zu gehen und zu arbeiten. Das ist besser, als es nicht auszuhalten.